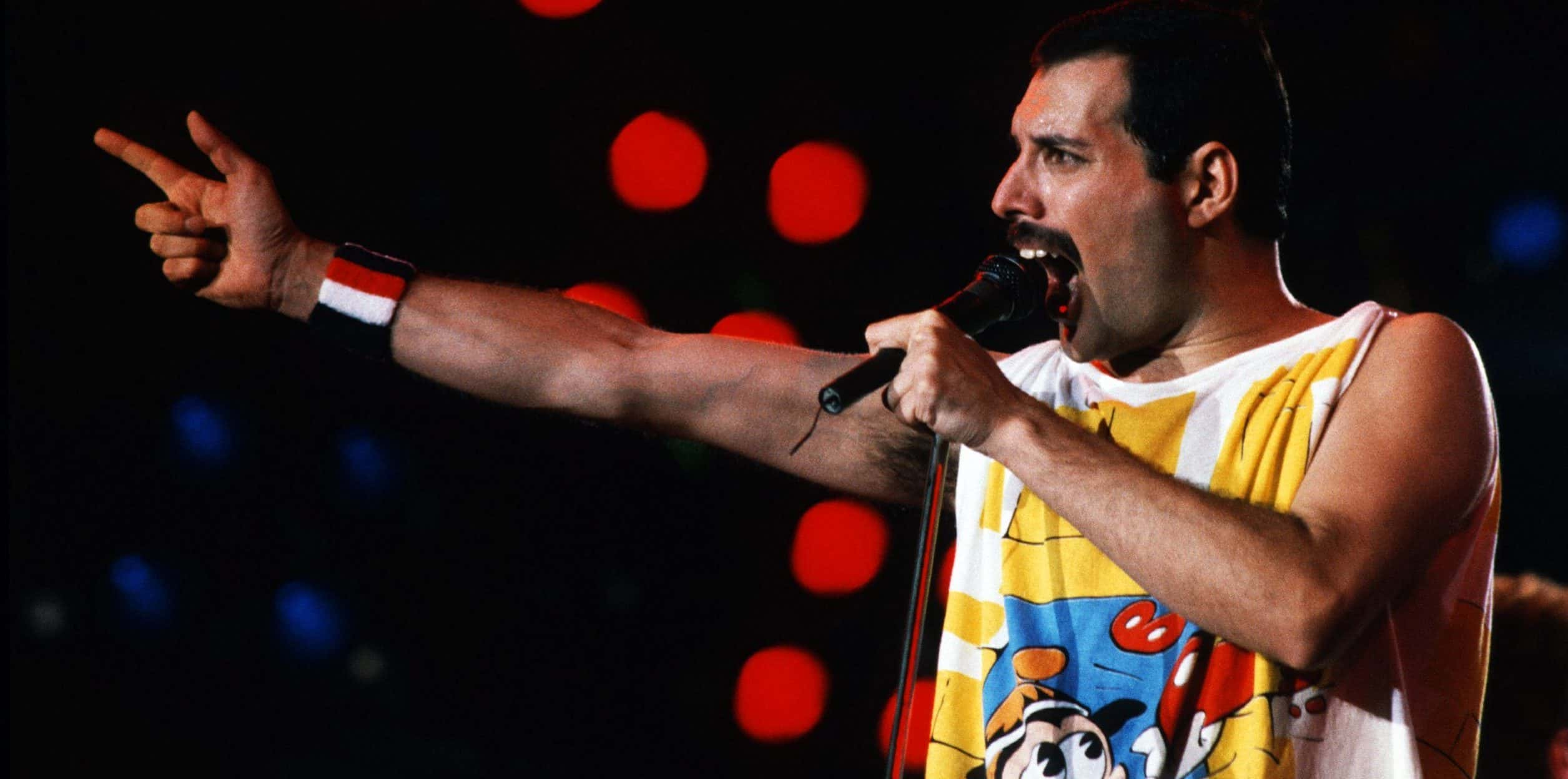Wolfgang Amadeus Mozart
Persönliche Daten
Vollständiger Name Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart
Geburtsdatum 27. Januar 1756
Geburtsort Salzburg, Heiliges Römisches Reich
Sterbedatum 5. Dezember 1791 (35 Jahre)
Sterbeort Wien, Heiliges Römisches Reich
Wolfgang Amadeus Mozart (getauft: Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart; Salzburg, 27. Januar 1756 – Wien, 5. Dezember 1791) war ein österreichischer Komponist und Pianist, einer der bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten der klassischen Musik weltweit.
Mozarts Werk umfasst über 600 Kompositionen, die nahezu jedes Genre seiner Zeit abdecken, darunter Symphonien, Konzerte, Kammermusik, Klaviermusik, Opern und Chorwerke.
In seiner frühesten Kindheit in Salzburg zeigte Mozart unglaubliche Fähigkeiten beim Spielen von Tasteninstrumenten und der Geige. Bereits mit fünf Jahren wurden seine Kompositionen und Auftritte von europäischem Adel und Aristokratie bewundert und geschätzt. Mit siebzehn Jahren erhielt er eine Anstellung als Hofmusiker in Salzburg. Doch er wurde unruhig und unzufrieden, reiste häufig auf der Suche nach besseren Positionen und komponierte unablässig. Während eines Wien-Besuchs 1781, nach seiner Entlassung am Hof, beschloss er, sich in der Stadt niederzulassen, wo er später Ruhm erlangte. Interessanterweise blieb Mozart bis zu seinem Lebensende in Wien, trotz schwerer finanzieller Nöte. In seinen letzten Jahren komponierte er viele berühmte Werke, darunter Symphonien, Konzerte, Opern und sein unvollendetes Requiem. Die Umstände seines frühen Todes sind bis heute Gegenstand von Spekulationen und haben Mozart zum Mythos werden lassen.
Frühe Kindheit
Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren, damals Hauptstadt des unabhängigen Erzbistums im Heiligen Römischen Reich. Er war der jüngste Sohn von Leopold Mozart und Anna Maria Mozart (geb. Pertl). Leopold war Vizekapellmeister am Hof des Salzburger Erzbischofs, komponierte gelegentlich Auftragswerke und war ein erfahrener Lehrer. Aufgrund der hohen Kindersterblichkeit in Europa überlebten von ihren sieben Kindern nur die ältere Schwester Maria Anna, genannt „Nannerl“, und Wolfgang Amadeus. Wolfgang wurde einen Tag nach seiner Geburt im Dom St. Rupert auf den Namen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart getauft. Er nannte sich selbst „Wolfgang Amadè Mozart“, doch wurden verschiedene Namensvarianten verwendet.
Mozart wurde geboren und verbrachte seine Kindheit bis zum Alter von siebzehn Jahren in der Getreidegasse Nr. 9 in Salzburg. Heute beherbergt dieses Haus zahlreiche Gegenstände, insbesondere Instrumente, aus Mozarts Kindheit. Es ist eine der meistbesuchten Stätten Salzburgs und ein Pilgerort für Musiker und Musikliebhaber weltweit.
Mozarts musikalische Begabung zeigte sich schon in frühester Kindheit. Sein Vater Leopold war einer der führenden Musikpädagogen Europas, dessen einflussreiches Lehrwerk Versuch einer gründlichen Violinschule im Geburtsjahr Mozarts erschien. Nach Wolfgangs Geburt vernachlässigte Leopold seine eigene Karriere, um sich ausschließlich der Ausbildung seines Sohnes zu widmen. Er brachte Wolfgang Geige und Klavier bei, und da der Junge schnell lernte, schrieb er bereits mit fünf Jahren erste Kompositionen. Leopold war sowohl Lehrer als auch Vater und stets bemüht, Wolfgang als Mensch und Künstler zu formen.
Leopold erkannte bald, dass er beträchtliche Einnahmen erzielen konnte, indem er seinen Sohn als Wunderkind an europäischen Höfen präsentierte. Als Mozart einmal erkrankte, äußerte Leopold größere Sorge um entgangene Einnahmen als um das Wohl seines Sohnes. Die ständigen Reisen und das raue Klima mögen zu Mozarts späteren Gesundheitsproblemen beigetragen haben. Mozarts ältere Schwester Nannerl war eine begabte Pianistin und begleitete Bruder und Vater häufig auf Tourneen.
Reisejahre (1762–73)
Während seiner musikalischen Lehrjahre bereiste Mozart ausgiebig Europa, beginnend mit einem Auftritt 1762 am Hof des Kurfürsten Maximilian III. von Bayern in München und am Kaiserhof in Wien. Eine lange Konzertreise führte die Familie an die Höfe von München, Mannheim, Paris, London, Dover, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Mechelen, zurück nach Paris und schließlich über Zürich, Donaueschingen und München nach Hause.
Leopold Mozart zögerte nicht, die Talente seiner Kinder zum gegenseitigen Nutzen einzusetzen. Sie sollten ihn im Alter versorgen. Eine dreiwöchige Tournee nach München im Januar 1762, als Mozart noch keine sechs Jahre alt war, war nur der Auftakt zu größeren Unternehmungen. Dieser frühe Erfolg führte bald zu einem längeren Aufenthalt in Wien bis Jahresende, mit Pflichtauftritten am Kaiserhof und großzügigen finanziellen Zuwendungen. In weniger als einem Monat in Wien deponierte Leopold 120 Golddukaten auf seinem Salzburger Bankkonto – mehr als das Doppelte eines durchschnittlichen Jahresgehalts.
Doch diese Ausflüge wurden von einer großen Tournee überschattet, die die vierköpfige Mozart-Familie über drei Jahre im Ausland hielt, von Juni 1763 bis November 1766. Ein Großteil dieser Reise verbrachten sie in wichtigen Musikzentren: fünf Monate in Paris, fünfzehn Monate in London und auf der Rückreise nochmals drei Monate in Paris, mit häufigen Zwischenstopps, hauptsächlich in deutschen Staaten und den Niederlanden. Der Ruhm des Geschwisterduos verbreitete sich in Westeuropa, mit vielen Gelegenheiten, ihren Charme und ihr frühreifes musikalisches Können zu zeigen.
In jeder Stadt konnten die Mozarts sicher auf Einladungen lokaler Herrscher, Adliger und reicher Aristokraten hoffen. Ein Auftritt führte typischerweise zu weiteren Einladungen. In London waren die Anzeigen für Mozarts Konzerte, weitgehend von Leopold verfasst, an den Adel gerichtet. Überall waren die Mozarts ausschließlich auf dieses elitäre Publikum angewiesen.

Mozart schrieb seine erste Symphonie mit acht Jahren. Möglicherweise transkribierte sein Vater einen Großteil der von Mozart produzierten Inhalte.
Wegen ihrer anhaltenden Erfolge und der mangelnden Bereitschaft, nach Salzburg zurückzukehren, verschoben sie ihre Heimreise immer wieder. Oft wurden sie mit Beifall und Gunst der Elite überschüttet, sowohl in Form von Anerkennung als auch Einkünften. Nach all dem erschien Salzburg als düstere Perspektive – finanziell, sozial und emotional. Es war ein Ort, wo Leopold Mozart nur ein schlecht bezahlter und wenig geschätzter Diener war. Als die Familie nach Salzburg zurückkehrte, war Mozart zehn Jahre alt und bereits ein erfahrener Interpret und Komponist.
Auf seinen Reisen traf er viele berühmte Musiker und lernte die Werke anderer großer Komponisten kennen, darunter Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn und Johann Christian Bach, der Mozart während ihrer Begegnungen in London 1764 und 1765 stark beeinflusste. Die Familie kehrte Ende 1767 nach Wien zurück und blieb bis Dezember 1768. Nach einem Jahr in Salzburg reisten Leopold und Wolfgang nach Italien und ließen Mozarts Mutter und Schwester zurück. Diese Reise dauerte von Dezember 1769 bis März 1771 und diente, wie frühere Reisen, dazu, das Talent des jungen Mannes als Interpret und zunehmend reifer Komponist zu präsentieren.
In Bologna traf er Josef Mysliveček und Giovanni Battista Martini und wurde in die berühmte Accademia Filarmonica aufgenommen. In Rom hörte er Gregorio Allegris Miserere in der Sixtinischen Kapelle und schrieb es anschließend vollständig aus dem Gedächtnis nieder, wobei er später nur kleinere Fehler korrigierte – die erste illegale Kopie dieses streng gehüteten Vatikan-Schatzes. Ursprung und Genauigkeit dieser Geschichte sind bis heute umstritten.
In Mailand komponierte Mozart 1770 die Oper Mitridate, re di Ponto, die erfolgreich aufgeführt wurde. Dies führte zu weiteren Opernaufträgen. Kurz darauf kehrten Leopold und Wolfgang zweimal nach Mailand zurück (August–Dezember 1771 und Oktober 1772–März 1773) für die Komposition und Uraufführung von Ascanio in Alba (1771) und Lucio Silla (1772). Leopold hoffte, diese Besuche würgen seinem Sohn eine Anstellung als Komponist in Italien verschaffen, doch diese Hoffnungen erfüllten sich nie.
Gegen Ende seines letzten Italien-Aufenthalts schrieb Mozart das heute häufig aufgeführte Motett Exsultate, jubilate, KV 165. Er befasste sich auch mit Erfindungen bedeutender Nicht-Musiker, wie Benjamin Franklins Glasharmonika, für die er mehrere Stücke komponierte.
Mozart am Salzburger Hof (1773–77)
Nach der endgültigen Rückkehr aus Italien mit seinem Vater am 13. März 1773 wurde Mozart als Hofmusiker beim Salzburger Landesherrn, Fürsterzbischof Hieronymus Colloredo, angestellt.
Der Komponist war ein Liebling in Salzburg, wo er viele Freunde und Bewunderer hatte. Hier hatte er Gelegenheit, in verschiedenen Genres zu arbeiten, darunter Symphonien, Sonaten, Streichquartette, Serenaden und einige kleinere Opern. Einige dieser Frühwerke werden heute noch aufgeführt. Von April bis Dezember 1775 entwickelte Mozart eine Leidenschaft für das Komponieren von Violinkonzerten und schuf eine Serie von fünf (die einzigen, die er je schrieb) mit stetig wachsender musikalischer Verfeinerung. Die letzten drei Violinkonzerte (KV 216, KV 218, KV 219) sind heute fester Bestandteil des Repertoires.
1776 widmete er sich Klavierkonzerten, deren Höhepunkt das Es-Dur-Konzert KV 271 Anfang 1777 war, das als Wendepunkt in seinem Schaffen gilt.
Trotz dieser künstlerischen Erfolge wurde Mozart zunehmend unzufrieden mit Salzburg und verstärkte seine Bemühungen, einen anderen Wohnort zu finden. Ein Grund war sein karges Gehalt von 150 Gulden jährlich, aber er sehnte sich auch danach, Opern zu komponieren, wofür Salzburg nur selten Gelegenheit bot. Die Situation verschlechterte sich 1775 mit der Schließung des Hoftheaters.
Zwei ausgedehnte Reisen auf Arbeitssuche (Leopold und Wolfgang suchten gemeinsam) unterbrachen diesen langen Salzburg-Aufenthalt: Sie besuchten Wien vom 14. Juli bis 26. September 1773 und München vom 6. Dezember 1774 bis März 1775. Keiner der Besuche führte zu einer neuen Anstellung, doch die München-Reise ermöglichte die erfolgreiche Uraufführung der Oper La finta giardiniera.
Aufenthalt in Paris (1777–78)
Mozart mit dem Orden vom Goldenen Sporn, verliehen von Papst Clemens XIV. 1770. Dies ist eine 1977 angefertigte Kopie des verlorenen Originals.
Im August 1777 kündigte Mozart seine Stelle in Salzburg und brach am 23. September zu einer weiteren Arbeitssuche auf, mit Stationen in Augsburg, Mannheim, Paris und München. Da Erzbischof Colloredo Leopold nicht die Reise erlaubte, begleitete Mozarts Mutter Anna Maria ihn.
Mozart freundete sich mit Mitgliedern der Mannheimer Hofkapelle an, des besten Orchesters Europas zu dieser Zeit. Es gab einige Aussichten auf eine Anstellung in Mannheim, doch nichts konkretisierte sich, und Mozart reiste am 14. März 1778 nach Paris, um seine Suche fortzusetzen. Sein Glück in Paris war kaum besser. In einem Brief nach Hause erwähnte er die Möglichkeit einer Stelle als Organist in Versailles, doch Mozart zeigte kein Interesse. Er geriet in Schulden und musste Wertgegenstände versetzen. Während dieses Aufenthalts erkrankte seine Mutter und starb am 3. Juli 1778.
Während Wolfgang in Paris war, suchte Leopold intensiv nach Möglichkeiten für dessen Rückkehr nach Salzburg. Mit Unterstützung lokaler Adliger sicherte er ihm eine bessere Stelle als Hoforganist und Konzertmeister mit einem Jahresgehalt von 450 Gulden – eine Position, die Wolfgang widerstrebend annahm. Nach seiner Abreise aus Paris am 26. September 1778 hielt er sich in Mannheim und München auf, immer noch in Hoffnung auf eine Anstellung außerhalb Salzburgs. In München traf er Aloysia wieder, inzwischen eine mäßig erfolgreiche Sängerin, die deutlich machte, dass sie kein Interesse mehr an ihm hatte.
Mozart kehrte schließlich am 15. Januar 1779 nach Hause zurück und trat seine neue Stelle an, doch seine Unzufriedenheit mit Salzburg blieb unvermindert.
Mozart in Wien (1781–1791)
Im Januar 1781 wurde Mozarts Oper Idomeneo mit „großem Erfolg“ in München uraufgeführt. Im März desselben Jahres wurde der Komponist nach Wien beordert, wo sein Arbeitgeber, Erzbischof Colloredo, an den Feierlichkeiten zur Thronbesteigung Josephs II. teilnahm. Frisch von der Bewunderung, die er in München erfahren hatte, fühlte sich Mozart gekränkt, als Colloredo ihn wie einen bloßen Diener behandelte, insbesondere als der Erzbischof ihm verbot, für den Kaiser bei Gräfin Thun gegen ein Honorar in Höhe der Hälfte seines Salzburger Jahresgehalts aufzutreten. Dies führte zu einem Streit, der im Mai mit Mozarts Entlassung auf höchst demütigende Weise gipfelte. In Wien jedoch erkannte Mozart lukrative Möglichkeiten und beschloss, sich dort als freischaffender Künstler und Komponist niederzulassen.
Der Konflikt mit dem Erzbischof wog schwerer, weil Mozarts Vater gegen ihn Partei ergriff. In der Hoffnung auf Wolfgangs bedingungslose Rückkehr zu Colloredo in Salzburg wechselte Leopold heftige Briefe mit seinem ungehorsamen Sohn und drängte auf Versöhnung mit dem Arbeitgeber. Doch Wolfgang verteidigte leidenschaftlich seinen Wunsch nach einer unabhängigen Karriere in Wien. Der Streit endete mit Mozarts Entlassung, die ihn von den Forderungen eines grausamen Arbeitgebers und eines überbesorgten Vaters befreite. Mozarts Biograph Solomon sah diesen Schritt als „revolutionär“ an, der den weiteren Lebensweg entscheidend verändern würde.
Das Jahr 1782 war ein erfolgreiches für Mozarts Karriere. Er trat häufig als Pianist auf, besonders bemerkenswert war ein Wettstreit mit Muzio Clementi am 24. Dezember 1781 vor dem Kaiser, und wurde bald als „bester Klavierspieler Wiens“ anerkannt. Seine Oper Die Entführung aus dem Serail war äußerst erfolgreich, und er veranstaltete eine Reihe von Konzerten, in denen er seine Werke als Komponist und Solist präsentierte.
Am 4. August 1782 heiratete er Constanze Weber gegen den Willen seines Vaters. Sie hatten sechs Kinder, von denen nur zwei das Kindesalter überlebten: Karl Thomas (1784–1858) und Franz Xaver Wolfgang